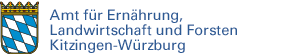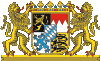30.10.2025
Aktuelle Pflanzenbauhinweise für Unterfranken
Pflanzenbauhinweise für den Regierungsbezirk Unterfranken vom Erzeugerring für landwirtschaftlich pflanzliche Qualitätsprodukte Würzburg e. V. und dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen-Würzburg.
Sachkundeschulungen – Neuer Dreijahreszeitraum für „Altsachkundige“
gilt aktuell der neue Fortbildungszeitraum 2025-2027. Entscheidend ist nicht der Abstand zur letzten Fortbildung,
sondern eine Teilnahme in jedem Dreijahreszeitraum.
Vom Erzeugerring werden ab Oktober wieder Vor-Ort und Online Fortbildungsveranstaltungen für den aktuellen Fortbildungszeitraum
2025-2027 angeboten.
Die Online-Anmeldung ist unter folgenden Links möglich:
Aktuelles zum Winterraps
Raps sollte mit ca. 8 bis 10 Blätter in den Winter gehen bei einem Wurzelhalsdurchmesser von ca. 8 – 10 mm. Damit hat die Pflanze im Frühjahr ein ausreichendes Nährstoffreservoir zur Verfügung. Um Auswinterungsschäden zu vermeiden, sollte der Raps im Herbst keinesfalls noch in das Längenwachstum übergehen. In bereits gut entwickelten, wüchsigen Beständen ist daher ein Einsatz von wachstumsregulierenden Fungiziden ratsam. Optimaler Einsatzzeitpunkt ist hierbei das 5–6 Blattstadium. Für eine gute Wirkung sollten die Tagestemperaturen über 10°C liegen. Die Aufwandmengen sind an die Entwicklung des Bestandes anzupassen. Für eine Verhinderung des Überwachsens gelten eher die höheren Aufwandmengen.
Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz von Belkar und LaDiva keine Ausbringung von Metconazol-haltigen Produkten (z.B. Carax, Caramba, Efilor) im Herbst erfolgen darf.
Zudem benötigt Raps schon im Herbst den Spurennährstoff Bor. Bor steigert die Vitalität der Pflanzen und erhöht zusätzlich die Winterhärte. Eine Bor-Zumischung zum Fungizid hat sich in der Größenordnung von ca. 150 – 200 Gramm je Hektar bewährt.
Aktuelles zum Wintergetreide
Sobald die Anwendungsbedingungen (Befahrbarkeit, Temperatur, Wind) passen, sollte auf Flächen v.a. auf Fuchsschwanzstandorten, der Einsatz eines Bodenherbizids (siehe RS 8/2025 oder VBH 2024 ab Seite 242 beschrieben) zeitig im Vorauflauf bis frühen Nachauflauf (EC 09-EC10) erfolgen. Wichtig für hohe Wirkungsgrade ist eine ausreichende Bodenfeuchte, damit die Wirkstoffe einen Film über die Bodenoberfläche legen können und so
besser von den Unkräutern aufgenommen werden Bei hohen Besatzdichten mit Ackerfuchsschwanz empfiehlt sich eine Spritzfolge von Bodenherbizid im Herbst und zeitiger Frühjahrsbehandlung mit dem blattaktiven Mittel Axial 50.
Beachten Sie bei der Anwendung die jeweiligen Indikationen der am Markt verfügbaren Produkte! Kaufen Sie diese nur noch sparsam nach Bedarf ein.
Die Genehmigung von Flufenacet wurde nicht mehr erneuert. Abverkaufsfristen gehen, je nach Präparat, von Dezember 2025 bis Juni 2026. Die Aufbrauchfristen enden spätestens zu 10. Dezember 2026. Danach sind Flufenacet-haltige Präparate entsorgungspflichtig!
Verzwergungsviren werden durch Läuse (Gerstengelbverzwergungsvirus - BYDV) bzw. durch eine Zwergzikadenart (Weizenverzwergungvirus - WDV) übertragen. Unabhängig von ihrem Namen können die Viren auf Gerste und Weizen, aber auch auf andere Getreidearten übertragen werden. Aus dem Monitoring auf Verzwergungsviren in Ausfallgetreide sind erste Ergebnisse vorhanden. Es wurden in Unterfranken 3x Wintergerste (WG) und 3x Sommergerste (SG) untersucht. 1 Probe war befallsfrei (WG); 1 Probe hatte nur BYDV (WG); 3 Proben hatten nur WDV (1 WG, 2 SG) und 1 Probe hatte BYDV und WDV (SG). Wie im Vorjahr war die nördliche Probe ohne Befund. Insgesamt ist ein leicht schwächerer Befall als im Jahr 2024 festzustellen. Die Ausfall-Sommergersten waren stärker befallen, da sie deutlich weiter entwickelt und deshalb vermutlich länger als Nahrungspflanze attraktiv waren.
Wichtig ist auch hierbei eine eigene Kontrolle der Bestände! Eine Bonitur der Blattläuse im eigenen Bestand sollte im 2-3 Blattstadium erfolgen und dabei an mindestens 50 Pflanzen im gesamten Bestand, am besten bei sonnigem Wetter am Nachmittag (für ein Läuseauftreten ist warme und trockene Herbstwitterung vorteilhaft), stattfinden. Bekämpfungsrichtwerte in Wintergerste sind hierbei 20 % mit Blattläusen befallene Pflanzen bei Normalsaaten. Bei früh gesäten Beständen (bis ca. 25.09.) liegt die Bekämpfungsschwelle bei 10%.
Behandeln Sie nur bei festgestellter Schwellenüberschreitung und frühstens ab dem 3-Blattstadium der Gerste. Beachten Sie beim Einsatz von Insektiziden immer den Bienenschutz. Falls in Ausnahmefällen schon eine BYDVresistente Sorte zum Anbau gekommenen ist, muss diese natürlich nicht behandelt werden.
Biodiversität im Ackerland - Beispiele zur Unterstützung
Verzichten Sie wo möglich auf „sauberes“ Abmähen vor dem Winter. Bearbeiten Sie nicht alle Streifen in einem Zug, sondern abschnittsweise. So wird eine Struktur aufrechterhalten, in die sich die Wildtiere zurückziehen können.
Wildvögel benötigen ganzjährig alte Grashalme. Viele Insekten nutzen Gras- und Krautstrukturen zur Überwinterung.
Zulassungsänderungen von Pflanzenschutzmitteln
Betroffen sind u.a. die Insektizide Nexide, Cooper, Xerxes und Mittel des Parallelhandels sowie die Herbizide Mistral und Biathlon 4D.
Beachten Sie zwingend die jeweiligen Aufbrauchfristen!!
Die EU-Kommission hat die Zulassung des Wirkstoffes Triflusulfuron nicht mehr verlängert. Entsprechend der Durchführungsverordnung (EU) 2023/2513 mussten Produkte mit dem Wirkstoff Triflusulfuron z.B. Debut oder Debut DuoActive bis spätestens 20. August 2024 aufgebraucht werden. D.h. im Jahr 2025 ist der Einsatz dieser Produkte verboten.
Zulassungen für Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Metribuzin (z.B. Arcade, Artist, Mistral, Citation, Sencor liquid, u.a.) werden spätestens am 24.05.2025 widerrufen. Restbestände solcher Mittel müssen spätestens 24.11.2025 aufgebraucht werden; d.h. 2025 endet der Metribuzineinsatz!